Kontrakt 903.
Erinnerung an eine strahlende Zukunft
Annett Gröschner : Text
Arwed Messmer : Bild
Mit Fotografien aus dem Archiv des Kernkraftwerkes Rheinsberg

192 Seiten / Format 230 x 165 mm
Französische Broschur
Ê
22
ISBN 3-931337-38-3
Annett Gröschner schreibt ein Buch über das Kernkraftwerk Rheinsberg und betritt damit Neuland. Noch nie hat jemand das Thema Kemenergie in Ost oder West literarisch behandelt.
„Ich will nicht sagen, ich bin dafür oder dagegen, ich will nur eine Geschichte erzählen.“ Von Januar bis Juni 1999 war Annett Gröschner Stadtschreiberin in Rheinsberg – in diesen sechs Monaten ging sie durch die Stadt und sprach mit den Kernkraftwerkern. Sie interviewte Ingenieure, Techniker, Arbeiter, den Bürgermeister, alteingesessene Rheinsberger – all die, die als junge Kräfte in den 60er Jahren in die verschlafene nordbrandenburgische Region geholt wurden, um ein beispielloses Projekt voranzutreiben: Das erste Kernkraftwerk der DDR. 1956 war der „Kontrakt 903“ geschlossen worden, ein Regierungsabkommen zwischen der DDR und der Sowjetunion. Der junge Staat sollte von den Erfahrungen der großen Atommacht profitieren und eine damals sensationell neue Technologie bekommen. Ein Kernkraftwerk mit einer Leistung zwischen 50 und 100 Megawatt war an den Ufern des Stechlins nahe Rheinsberg geplant, zeitgleich gebaut mit einem Kernkraftwerk in Nowo Woronesh. 1966 bekam das Rheinsberger Kernkraftwerk die Betriebsgenehmigung, 1990 wurde es abgeschaltet. Auf den Tag genau 35 Jahre nach der Einweihung endete am 8. Mai 2001 mit dem letzten Castortransport die „strahlende Zukunft“.
„Atom wird Helfer, und du siehst das Morgen, den hohen, hellen Schornstein, der nicht raucht“, hatte damals jemand geschrieben, „und das war ja ein durchaus berechtigter Gedanke“, sagt Annett Gröschner. „Wenn es eine Technologie gäbe, bei der dieses Land nicht ausgebaggert werden muß, für die Braunkohle...“ Die Geschichte der DDR und die Geschichte der Kernkraft sind in ihrem Text untrennbar verbunden. Am Anfang Euphorie, Improvisation, aber auch Kontrolle und Bevormundung durch die Sowjetmacht. „Es gab technologisch für kurze Zeit einen Gleichstand mit dem Westen, obwohl man immer improvisieren musste. Die Ingenieure haben aus nichts etwas gemacht. Und darauf waren sie auch stolz.“ Später kamen Schlamperei und Mangelwirtschaft. Sicherheitsdenken wie im Westen war fremd, erst nach Tschernobyl machte man sich auch in Rheinsberg Gedanken. Eine Generalreparatur wurde aber immer wieder verschoben, weil die 70 Megawatt Leistung dringend gebraucht wurden.
„In Rheinsberg habe ich mich mit einer Generation unterhalten, die am Anfang ihres Arbeitslebens dorthin kam, den Reaktor aufbaute, und am Ende wieder abbaute und nach Hause ging. Dieser Kreislauf war es, der mich interessierte.“ Annett Gröschners Buch ist Literatur und Dokumentation zugleich, eine dramatische Erzählung in sechs Kapiteln, mit vielen Schwarzweißfotos aus dem Archiv des Kraftwerkes und Farbbildern des Fotografen Arwed Messmer. Ein Kunstobjekt zur Geschichte einer unbeherrschbaren Technologie.
[Nach Jan Sternberg]
Grummelnder Stechlin
Annett Gröschner vermisst die strahlende Zukunft der DDR
Kurt Tucholsky belobigte in seinem kleinen Roman „Rheinsberg“ die Ortsbewohner angesichts der lokalen Schaufensterauslagen für ihr Bemühen, hübsch mithalten zu wollen mit der unaufhaltsamen Moderne. Den Anschluss der Rheinsberger Gegend an das große Weltbeben hatte einige Jahrzehnte zuvor bereits Theodor Fontane in seinem großen Altersroman „Der Stechlin“ mit der berühmten Stelle über den kleinen, geheimnisvollen See im Brandenburgischen ausgelotet. „Und doch, von Zeit zu Zeit“, heißt es bei Fontane, „wird es an eben dieser Stelle lebendig. Das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei's auf Island, sei's auf Java, zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Aschenregen der hawaiischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann regt sich's auch hier, und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechlin umwohnen. (...)“
Der brandenburgische Teil der mecklenburgischen Seenplatte ist seit Fontane literarisiertes Gelände, das zuvor bereits vom preußischen Weltgeist bewohnt war. Friedrich der Große hat hier seine Jugendjahre verbracht, die durch die Hinrichtung seines Freundes Katte tragisch endeten und Friedrichs sonderbarer Bruder Prinz Heinrich blieb noch darüber hinaus im Schloss in der Ostprignitz. Dann wurde es still um Rheinsberg, aber die Fontanesche Ahnung über das Grummeln im See vergaß man wohl nie.
Die Berliner Schriftstellerin Annett Gröschner hat nun erneut einen Stein in den Stechlin geworfen, um ein bedeutsames Kapitel der Technikgeschichte der DDR nicht bloß den Archiven zu überlassen. Begonnen hatte es mit einer Recherche, die die Schriftstellerin mit ihrem Hang zum Semi-Dokumentarischen 1999 als Stadtschreiberin von Rheinsberg unternommen hatte. Herausgekommen ist das Buch „Kontrakt 903. Erinnerung an eine strahlende Zukunft“, eine faszinierende Textkomposition aus Zeitdokumenten, aus den Stimmen Beteiligter, Archivmaterial und Geschichtszeugnissen. Die Stadtschreiberin ist im Konvolut ihres Materials bloß eine Figur, die sparsam sortiert, Ergänzungen macht und Übergänge herstellt. Schon nach ein paar Seiten hat der Stein Ringe auf die Wasseroberfläche geworfen, gegenüber denen einestärker gestaltende Autorhand schlicht machtlos wäre, als seien hier andere Kräfte im Spiel.
„Kontrakt 903“, das Buch, erzählt von Erwartungen und Ernüchterungen. Junge, gut ausgebildete Fachkräfte und Arbeiter kamen mit der Verlockung materieller Aufstiegschancen nach Rheinsberg, und bekamen für ein paar Monate, die für einige zu einem halben Leben wurden, den fiebrigen Atem einer DDR-Moderne am wiederbelebten Geschichtsort zu spüren. „Ich war 20 und kam mit dem Vater nicht klar“, sagt der Eisenbieger, „und da bin ich eines Tages von zu Hause abgehauen“. In Rheinsberg suchten sie Eisenbieger. „Ich konnte gleich anfangen, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist.“
Indem Annett Gröschner das Kraftwerkspersonal befragte, einfache Leute ebenso wie die technische Elite und deren Angehörige, konnte sie minutiös eine Werkgeschichte ermitteln. Manchmal geht ein Hauch von Geselligkeit durch den Text, den sich die Kulturfunktionäre beim Ausrufen des „Bitterfelder Weges“ wohl gewünscht hatten. Tatsächlich schreitet Annett Gröschner bei ihrer Recherche ganz nebenbei noch einmal den Staatsauftrag zu einer Literatur der Arbeitswelt ab. Die Dokumente aber sind störrisch bis ironisch und machen auch vor Tragischem nicht halt, etwa in der Aussagen der Witwe der strahlenexponierten Person der Kategorie A, deren Mann an Leukämie stirbt.
Gröschners „Kontrakt 903“ erzählt eine poetisch aufgeladene Rheinsberger Kraftwerksgeschichte mit den soziologischen Mitteln einer oral history, die ihre ganze Spannung aus der jederzeit spürbaren Sympathie der Stadtschreiberin für das interviewte Personal bezieht. In Gröschners Text, der nicht zuletzt das Kapitel einer Alltagsgeschichte der DDR ist, wird nichts verklärt noch beschworen, zugleich aber ist diese nüchterne Bestandsaufnahme frei von jeglicher Abrechnungslust und Verrat - ganz so, als würde hier der Versuch unternommen, die Bedingungen zu erforschen, unter denen man die DDR auch hätte gern haben können.
Ganz still und leise, und mit einer gehörigen Portion Eigensinn, unternimmt Annett Gröschner, eine Autorin der mittleren Generation, sie ist Jahrgang 1964, einen Ausflug in die DDR-Geschichte und verfolgt zur Zeit eines der spannenderen Projekte der Gegenwartsliteratur.
Harry Nutt, Frankfurter Rundschau
Vision grüne Wiese
Als Annett Gröschner 1999 für ein halbes Jahr die Stadtschreiber-Wohnung in Rheinsberg bezog, wollte sie nur ihren inzwischen sehr erfolgreichen Roman „Moskauer Eis“ vollenden. Weder Kurt Tucholsky noch die Untiefen der preußischen Geschichte hätten sie davon ablenken können. Doch dann stieß sie auf dieses noch unbewältigte Betonungetüm mitten im Wald. Die 1964 in Magdeburg geborene Autorin wurde schwach und fing an, schon ihr übernächstes Buch zu recherchieren. So gern sich Annett Gröschner auch von ingenieurtechnischen Details faszinieren lässt, nie wollte sie ein Buch schreiben, um Argumente und Diskussionen darzustellen. Sie ist Schriftstellerin und interessiert sich dafür, wie Menschen mit der Gesellschaft und dem Leben klarkommen. Die Rheinsberger, bemerkte sie, verfügen über außergewöhnliche Erfahrungen. In das verträumte 4556-Einwohner-Städtchen (1963) waren bis 1970 zusätzlich 1179 Arbeiter und Experten gezogen, um das erste Atomkraftwerk der DDR aus dem Boden zu stampfen. „Wir waren Teil einer Utopie, aber manchmal haben Utopien eben eine kurze Halbwertzeit“, resümiert eine ehemalige Konstrukteurin. Nicht wenige der Erbauer sind derzeit und bis zu ihrer Pensionierung damit beschäftigt, das Atomkraftwerk wieder abzutragen. Die neue Vision für den Ort klingt schlicht, ist aber offenbar noch utopischer: Eine radioaktiv unverstrahlte Wiese soll wieder her.
Annett Gröschner zog also aus, um Hinz und Kunz, Hilfsarbeiter und Chefs über ihr persönliches Verhältnis zum AKW Rheinsberg zu interviewen. Außerdem setzte sich die Autorin in mehrere Archive und förderte inoffizielle Vorgänge und offizielle Verlautbarungen über das Kraftwerk zu Tage. Herausgekommen ist eine Textcollage. Das gewählte vielstimmige Erzählprinzip ist gewiss nicht neu, doch Annett Gröschner geht einen Schritt weiter. Sie komprimiert den Stoff auf eindrucksvolle Weise. Manchmal sind es nur ein, zwei Sätze aus dem Munde ihrer Berichterstatter, die den Erzählfaden weiterspinnen. Eine nächste Stimme kann dem Vorredner widersprechen. Jeder im Kollektiv behält auf seine Weise recht. Die menschlichen Quellen werden nie mit Namen genannt, sondern typisiert. „Die Aufbauleitung“: „Jeder Eingestellte ist verpflichtet, weder nach Westdeutschland noch nach Westberlin zu reisen.“ Darauf „Der Eisenbieger“: „Fast jedes Wochenende fuhren wir nach Westberlin. Offiziell, um uns Zangen zu kaufen, denn die aus dem Osten konntest du nicht mal für Nägel gebrauchen. Ich hatte in Berlin einen Kumpel, der bei seiner Mutter lebte, und bei dem habe ich dann geschlafen...“
Auf diese Weise werden geschichtsfähige Aussagen und private Aspekte facettenreich ineinander verschränkt. Aus den unzähligen Mosaiksteinchen ergeben sich anschauliche Vexierbilder. Alltags- und Lebenskultur wird durch die O-Töne sehr viel lebendiger als in Geschichtsbüchern. Werksküchenessen und Betriebsfeste, Westfernsehen und Wohnungsnot, Kirchenmitgliedschaft und der tägliche Einkauf spielen in den Erinnerungen eine Rolle. Eingeblendet werden auch Berichte über die kulturelle Arbeit im Kulturhaus des AKW: „Sehr beliebt sind Sportveranstaltungen und Tanzabende. Letztere mit modernen Klangkörpern, wie Big-Beat-Bands oder Gitarrensounds. Die herkömmliche Art von Tanzkapellen wird fast abgelehnt.“
Die Autorin möchte dem Leser nichts suggerieren und am allerwenigsten eine Meinung über Atomkraft vorkauen. Eine Erzählfigur nennt sie „Die Witwe der strahlenexponierten Person der Kategorie A“. Diese berichtet von sich selbst: „Ich habe angefangen mit 380 Mark, und dann hab ich gehofft, dass ich im aktiven Teil arbeiten kann, weil man da 25 Mark Strahlengeld kriegte.“ Manchmal bringt sich Annett Gröschner als „Die Stadtschreiberin" selbst in den Erzähl-Chor ein. Etwa um einen Fakt einzuwerfen: „Wie viel der Bau am Ende wirklich kostete, wusste niemand. Ende 1965 ging man davon aus, dass die anfänglich veranschlagte Summe von ungefähr 158 Millionen Mark um 1000 Prozent überschritten wurde.“ Die Autorin spannt den zeitlichen Bogen bis zum „Castor“, dem letzten Abtransport von radioaktivem Material im Mai 2001, bei dem 5700 Beamte und 40 Hubschrauber gegen 100 friedliche Atomkraftgegner im Einsatz waren.
Annett Gröschner bestand von vornherein auf einer Zusammenarbeit mit dem Fotografen Arwed Messmer. Die Bildarbeit mit aktuellen und historischen Aufnahmen könnte souveräner und angemessener nicht sein. Ein innovatives, aber jedermann einleuchtendes Buch.
Karim Saab, Märkische Allgemeine Zeitung
Strahlende Zukunft
Überm Stechlin glüht es. Es brennt nicht wirklich. Es strahlt auch nicht unsichtbar. Das hat es nie, wie uns später die alten Ingenieure versichern werden, die noch immer stolz sind auf ihre Technik. Nein, an diesem Vormittag lodert der herbstliche Wald in den weiten Himmel. Der See liegt spiegelglatt, kein Boot, noch nicht einmal ein Habicht, von dem Fontane erzählt. Neuglobsow ist schon in frühe Winterruhe gefallen. Vom Bootssteg aus kann man Richtung Westen einen Schornstein erkennen. Harmlos sieht der aus. Demnächst soll er wieder Farbe tragen, hören wir. Wegen der Flugzeuge.
Wir tasten uns durch den Wald am Zaun entlang voran. Dieser Zaun, keine zwei Meter hoch und mit einfachem Stacheldraht bewehrt, irritiert mich. In Rheinsberg, erzählt später die Stadtschreiberin, habe man das Gelände anfangs sogar nur durch einen Holzzaun geschützt. Erst als sich Tiere darunter durchgruben und sich auf dem Kraftwerkgelände breitmachten, bemühte man sich um stabilere Abgrenzung. Angst vor terroristischen Anschlägen? Vor Sabotage? Industriespionage? Woher denn! Doch nicht im ersten Arbeiter- und Bauernstaat. Dort gehörte die Technik dem Volk.
Auf brandenburgischen Sand haben sie das Kernkraftwerk Rheinsberg gesetzt, das erste überhaupt in der deutsch-deutschen Geschichte. Es ist auch das Erste, das wieder abgebaut wird, Rückbau und Stilllegung nennt sich das, was seit 1990 dort passiert. Wir wollen uns ansehen, was vom „Kontrakt 903“ übriggeblieben ist, dem beispiellosen Techniktransfer zwischen dem großen Bruder Sowjetunion und der kleinen DDR. Das war 1958. Die Rheinsberger Stadtschreiberin hat seine Spur aufgenommen. Wir folgen ihr.
Für die ausschließlich „friedliche Nutzung der Kernenergie“ bürgen schon die Tauben im Eingangstor. Dahinter ein Pulk Kollegen, die aussehen, als hätten sie früher mal zum ständigen Blockiererpersonal (West) gehört. Zwischen ihnen ältere Herren, die wehmütigen Auges übers Gelände irren. Die Besichtigung führt uns am „Sozialbau" vorbei ins Kraftwerkgebäude. Lindgrün und rostrot, original sechziger Jahre, geht es durch lange, knastähnliche Gänge. Mit 70 Megawatt, erzählt uns unser Führer, war Rheinsberg ein vergleichsweise kleines Kraftwerk.
Wir stehen in der entkernten Halle, die vor fünfzehn Jahren noch „heiß“ fuhr und Saft in den bereits siechen Staat pumpte. Verdampferanlage, Kühlkreislauf, Dampferzeuger, Turbine, Generator, Abklingbecken... die Begriffe fliegen an uns vorbei. Gelegentlich macht jemand durch Laienkenntnis auf sich aufmerksam. Ich erinnere mich an Flusserwärmung, Grundwasserabsenkung. Warum es eigentlich keine Kühltürme gäbe, fragt jemand. Die Seen! Der Stechlin! Auf ein Grad Erwärmung habe man es damals gebracht, wird ein Kraftwerker berichten. Wer je im Stechlin gebadet hat, wird das zu schätzen wissen.
Das Kontrollzentrum. Klobige schwarze Hebel und Knöpfe. Vorsintflutliche Kontrolllampen, Messgeräte. Keine Computer. Das Ganze erinnert an einen Science-Fiction-Film aus den fünfziger Jahren. Ist ja auch nicht so falsch. Energie aus Kernspaltung war selbst für technikbegeisterte Ostler gespenstisch. Im hinterwäldlerischen Rheinsberg war man vom „Kontrakt 903“ ohnehin wenig begeistert. Man fürchtete um die Sommerfrischler.
Wir kommen am sogenannten Zwischenlager für feste und flüssige radioaktive Betriebsabfälle vorbei. Dort wird auch der „Aushub“ gelagert, bevor er „reingemessen“ wird und unbedenklich wieder verwendet werden kann. Überall liegen Steinbrocken herum. Über 17 Tausend Tonnen Abbau bis Ende 2001, registriert eine Werbebroschüre. Überreste einer strahlenden Zukunft. Das Unwohlsein steht den Besuchern ins Gesicht geschrieben.
Im museal wirkenden „Sozialbau“ stellt die Stadtschreiberin ihr Buch vor. Es handelt vom einst erfolgversprechenden sozialen Laborversuch (DDR) und von der Technikeuphorie seiner Probanden. Die Stadtschreiberin gibt sich lakonisch. Die Kraftwerker sehen ihr Aufbauwerk nicht gewürdigt. Strahlenunfälle, widerspricht der Leiter unbeholfen, habe es in Rheinsberg nie gegeben. Die Kraftwerker, sagt auch die Stadtschreiberin, waren eine Familie. Den Russen, sagen die Ingenieure, sind wir zu gründlich gewesen. Während in Moskau noch geplant wurde, wurde in Rheinsberg schon gebaut, liest die Stadtschreiberin vor. Geklaut, sagen die Kraftwerker, haben alle.
Nach der Lesung wird Wasser gereicht. Im Werk herrscht Alkoholverbot. Mit den Russen, wiederholen die Kraftwerker, sei es manchmal schwierig gewesen. Aber abends habe man sich immer wieder verbrüdert. Was auch immer das heißen mag.
Ulrike Baureithel, Freitag
Als die Utopie lebte:
Annett Gröschners Buch über das Kernkraftwerk in Rheinsberg
Wer heute von Berlin aus einen Ausflug nach Rheinsberg plant, der hat vor allem das wunderschöne Rokoko-Schloss im Kopf, den dazugehörigen Park und Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Dass ausgerechnet im idyllischen Rheinsberg das erste Kernkraftwerk der DDR stand - ein Kernkraftwerk, das 1966 ans Netz ging und erst 1992 abgeschaltet wurde - ist den meisten nicht präsent. Umso schöner, dass man jetzt begeisterten Ausflüglern noch pünktlich zum Auftakt der Frühlings-Saison das Buch „Kontrakt 903. Erinnerungen an eine strahlende Zukunft“ von Annett Gröschner schenken kann.
Die Berliner Schriftstellerin war 1999 Stadtschreiberin von Rheinsberg. In der besten Tradition der Dokumentarliteratur, wie man sie von Erika Runges „Bottropper Protokollen“ kennt oder auch von Alexander Kluge oder Walter Kempowski, lässt Annett Gröschner Zeitzeugen, Archivmaterial und weitere Quellen weitgehend für sich sprechen. Die Kommentierung ergibt sich aus der Anordnung und den wechselseitigen Bezügen, die ein Gitter schaffen, das der Phantasie des Lesers kaum Grenzen setzt. Die zahlreichen Fotos aus den Archiven, aber auch die phantastischen Porträts von Arwed Messmer, der viele der Befragten einfach stoisch in die Kamera hat blicken lassen, tun das Ihre dazu.
Nach und nach erst, beim wiederholten Blättern, kristallisieren sich einzelne Charaktere wie „die Konstrukteurin“ oder „die Chefsekretärin“ heraus und zugleich das Besondere ihrer Geschichte: Das Kernkraftwerk Rheinsberg war kein x-beliebiger Industriebetrieb in der DDR, Rheinsberg war ein utopischer Ort, an dem anfangs eine enorme Aufbruchstimmung herrschte und an dem man heute viele abgewickelte Biografien ausgraben kann, die jetzt nur noch wehmütig auf ihre „strahlende Zukunft“ zurückblicken können.
Es ist absolut mit- und hinreißend, wie sich einige der ehemaligen Angestellten an den Enthusiasmus erinnern, mit dem sie in den späten Fünfziger- und den frühen Sechzigerjahren ihr neues Leben im Kernkraftwerk angingen. Die Wohnviertel, die für die Arbeiter extra aus dem Boden gestampft wurden, entsprachen den höchsten Standards der Zeit. Außerdem wurde ein Kulturgebäude errichtet für Hochzeiten, Betriebsfeste, Konzerte, Kino und Karneval, wovon noch heute alle begeistert schwärmen. Die Arbeiter des Kernkraftwerks müssen sich gefühlt haben wie eine verschworene, privilegierte Gemeinschaft: „Wir waren alle Anfang 20. Alle waren neu, keiner hatte Verwandte, Eltern oder Mütter, die weder reingeredet noch geholfen haben“, berichtet einmal die Konstrukteurin - und dass in dieser Zeit fast alle Angestellten des Kernkraftwerks gleichzeitig Kinder bekommen haben.
Besonders an den Stellen, wo es nicht nur um einen Betrieb geht, der als Projektionsfläche für große Hoffnungen taugte, sondern um den Umgang mit der Gefahr, die von einem Atomkraftwerk nun mal ausgeht, ist die Montagetechnik, die Annett Gröschner in ihrem Buch anwendet, mehr als hilfreich. Der Zusammenprall der Sprache der Partei, die mit dem Kernkraftwerk international Werbung zu machen hoffte, und privaten Erinnerungen einzelner Arbeiter, die vom praktizierten Dilettantismus erzählen, ist manchmal kurios: Wie sie entgegen aller Propaganda daran festhalten, dass die Arbeitsorganisation schlecht war, dass bis in die Siebzigerjahre hinein die Sicherheitsvorkehrungen genauso mangelhaft waren wie die Informationspolitik, dass es eine Zeitlang en vogue war, Silvester im 18 Grad warmen Auslaufkanal zu baden und dass viele erst Angst bekamen, als Tschernobyl passierte.
Das Ende von „Kontrakt 903. Erinnerungen an eine strahlende Zukunft“ liest sich naturgemäß traurig. So sinnvoll es war, ein klappriges Kernkraftwerk wie Rheinsberg abzuschalten - die Depression, die sich nach dem Wegfall des größten Arbeitgebers über Rheinsberg legte, ist bis heute nicht bezwungen: Die Einwohnerzahl sinkt und die Stadt überaltert immer mehr. Viele der ehemaligen Angestellten wissen nicht mehr, was tun. Und wieder ist es die Konstrukteurin, die am Ende für den schönsten Satz im ganzen Buch gesorgt hat: „Wir waren Teil einer Utopie, aber manchmal haben Utopien eben eine kurze Halbwertszeit.“
Susanne Messmer, die tageszeitung
Wunder der Technik
Warum es sich im Auslaufkanal des Kernkraftwerks Rheinsberg auch zu Silvester warm baden ließ: Annett Gröschner sprach mit ehemaligen Mitarbeitern und Anwohnern
Die so schön doppeldeutig strahlende Zukunft, um die es im Untertitel von »Kontrakt 903« geht, bezieht sich auf das DDR-Kernkraftwerk in Rheinsberg. Natürlich klingt das so gleich ein bißchen ironisch, aber ein bißchen melancholisch klingt es auch, so nach aus und vorbei, gebrochenen Versprechen, nach menschlicher Hybris und menschlicher Dummheit. Warum aber sollte man, der man sich ja links und womöglich auch ökologisch orientiert definiert, ein Buch über das Kernkraftwerk Rheinsberg lesen, das 35 Jahre lief und 1990 abgeschaltet wurde, da es – wie der damalige Leiter betont – veraltet und der Ausbau nicht mehr rentabel war? Warum ein mehr oder minder glücklich geschlossenes Kapitel Fortschrittswahnsinn wieder öffnen?
Zum einen erhalten Leserinnen und Leser einen einmaligen Einblick in die Technikgeschichte der DDR. Zum anderen versteht sich Annett Gröschner wie wenige darauf, Leute reden zu lassen und daraus eine Geschichte zu bauen, die eine perfekte, interessante und spannende Mischung aus Erzählung und Dokumentation ist und auch so etwas wie Geschichte für alle. »Kontrakt 903« ist eine Montage aus Stimmen und Zitaten verschiedener Herkunft. Das Kernkraftwerk Rheinsberg wurde in unmittelbarer Nähe des Stechlin gebaut, des Brandenburger Sees, der Theodor Fontanes Roman den Namen gab. »Rheinsberg« heißt ein Kurzroman von Kurt Tucholsky, und auch Brigitte Reimann hat ihre »Beobachtungen zu Rheinsberg« hinterlassen – ihr Statement ist eher niederschmetternd: »Dort ist die Welt mit Brettern vernagelt, die Eisenbahnlinie endet hier, das Städtchen ist winzig und kulturlos und hat nichts vom Lärm anderer Städte.« Und so ist es auch am Anfang für viele, die da arbeiten oder arbeiten müssen und die kamen, weil sie sich einen Neuanfang oder materiellen Wohlstand erhofften: deprimierend, veraltet, im Nichts und Nirgendwo, der Boden ist sumpfig, das erschwert den Bau. Andererseits eröffnet das KKW Rheinsberg auch Chancen für die Stadt und für die Leute, die ihre Arbeit in euphorischer Aufbruchsstimmung anfangen. Nicht zuletzt ist da die Landschaft, heute Naturschutzgebiet, wunderschön. Das übrigens betonen alle. »[Die Chefsekretärin:] ... So richtig wollte ich eigentlich nicht, aber ich dachte, du kannst es dir ja mal angucken. Das war Ende Februar 1958. Und da war noch mal ein Wintereinbruch, auf dem Stechlin waren die Eisschollen hochgetürmt, und da hat mir die Landschaft so zugesagt, daß ich gesagt habe, ich komme.«
Annett Gröschner war im ersten Halbjahr 1999 Stadtschreiberin von Rheinsberg und befaßt sich seitdem mit diesem Kernkraftwerk, das zehn Kilometer von der Stadt entfernt gebaut wurde. Seit 2000 hat sie der Fotograf Arwed Messmer begleitet. Die Fotos, gleichfalls um Privat- und Archivmaterial ergänzt, bleiben ohne Titel, illustrieren nicht direkt, sondern müssen zuweilen mit eigener Phantasie in den Fortlauf der Geschichte eingebaut werden. Sie ergänzen und kontrastieren die Stimmen, die Gröschner gesammelt hat – darunter übrigens auch ihre eigene, die sie wie alle anderen – die von einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern und studierten Fachkräften (wie vom Ingenieur, vom Forscher, vom Eisenbieger, von der Deutschlehrerin, von der Konstrukteurin, von der Chefsekretärin, vom Bürgermeister, von der Witwe der strahlenexponierten Person der Kategorie A) – nur diskret kenntlich macht. Aus diesen vielen Stimmen, die Gröschner wie Puzzleteilchen zusammensetzt, entsteht eine durchgängige Handlungslinie. Wie wurde mit der Sowjetunion zusammengearbeitet, die der DDR einiges an Know-how lieferte – der titelgebende Kontrakt 903 bezieht sich schließlich auf dieses Regierungsabkommen zwischen DDR und UdSSR? Wie waren die Abläufe auf der Baustelle, wie hat der KKW-Betrieb funktioniert, wie haben die Menschen gelebt und gearbeitet, was wurde gegessen, wie wurde gewohnt, wie war der Kontakt mit der Stadt, mischte die Partei sich ein, wie wurde mit der Gefahr Atomenergie umgegangen, wie wurde sie propagiert und kontrolliert?
»[Der Physiklehrer:] Eine Attraktion war, zu Silvester zum Kernkraftwerk zu laufen und im 18 Grad warmen Wasser des Auslaufkanals zu baden. ... [Die Chefsekretärin:] Natürlich waren die Sicherheitsbestimmungen streng. Wenn die jetzt immer so tun, bei uns war alles so primitiv, dann werde ich wütend. Wir waren ja keine Dummen und die Leute, die die Anlagen hier geleitet haben, das waren alles Kapazitäten.« – »[Der Eisenbieger:] Die Eisenbieger wurden von allen politischen Ereignissen ferngehalten. Wir haben gesagt, wir wollen arbeiten und weiter gar nichts ... Wir hatten in der Brigade ein Parteimitglied, der hat gar nicht erst versucht zu diskutieren. Der ist irgendwann sogar mit nach Berlin gefahren.« – »[Aus den Akten des Brandenburgischen Landeshauptarchivs:]: Wir, die Betonbrigade Krause, sind lauter parteilose Kollegen. Aber das Wort der Arbeiterpartei gilt auch für uns. In der Unterstützung der Gramm- und Millimeterbewegung zum sparsamsten Umgang mit Material bestellen wir nur soviel Beton wie unbedingt nötig. Bei uns wird nichts abgekippt. Unsere Losung lautet: Pro Monat 3 000 Kubikmeter Beton für Frieden und Sozialismus.«
Annett Gröschner schafft es, anteilnehmend und sachlich zugleich zu bleiben. Ab und an streut sie einen trockenen Satz ein, der ein anderes Schlaglicht wirft: »Da die Perspektiven des Werkes auch 1962 noch unklar blieben, beschäftigte sich die Betriebsleitung mit einem unter Kommunisten seit Jahrzehnten erprobten und bewährten Spiel.« Das hieße wohl heute Mobbing. Gröschner kommentiert nicht und sie wertet nicht – das können die Leser selbst, die Sachverhalte sind klar genug. Wenn in den Zitaten Meinung gemacht wird, dann ist das meist kenntlich, wirkt manchmal in der Rückblende unfreiwillig komisch oder ironisch, weil die Geschichte sich ad absurdum geführt hat oder Parteilosungen eben dümmlich und pompös sind und mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben. Gröschner beschönigt nichts und hat schon gar keine Häme nötig – aber sie hat viel Neugier und viel Interesse für ihren Forschungsgegenstand und ihre Interviewpartner. Die Interviews mit Zeitzeugen werden ergänzt durch Auszüge aus Archivmaterial, Zeitungsberichte, Agitprop und Akten, mit Kinderpropaganda von den Abenteuern des kleinen Atomino, der seiner Spielgefährtin das Wasser zum Baden erwärmt. Das Gesamtbild ist fremd und vertraut, realistisch allemal. Dazu gehören Aufbruchstimmung, Arbeitsalltag, Enthusiasmus, Organisationsprobleme, Streitigkeiten, Normarbeit, Zusammenhalt, Schlampereien beim Umgang mit dem Handwerkszeug, Sicherheitsbestimmungen, Karnevalsclub, Kernkraftwerkskapelle, Kernkraftwerkskabarett, Mauerbau, Maueröffnung, Tschernobyl, Castortransport und der Tod eines 48jährigen Arbeiters durch Leukämie.
Tine Plesch, junge welt


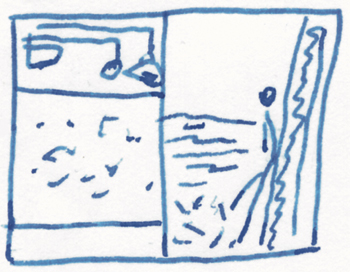




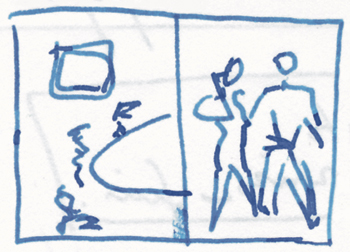

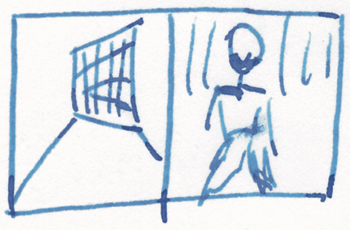
Annett Gröschner : Zeichnungen zum Buch